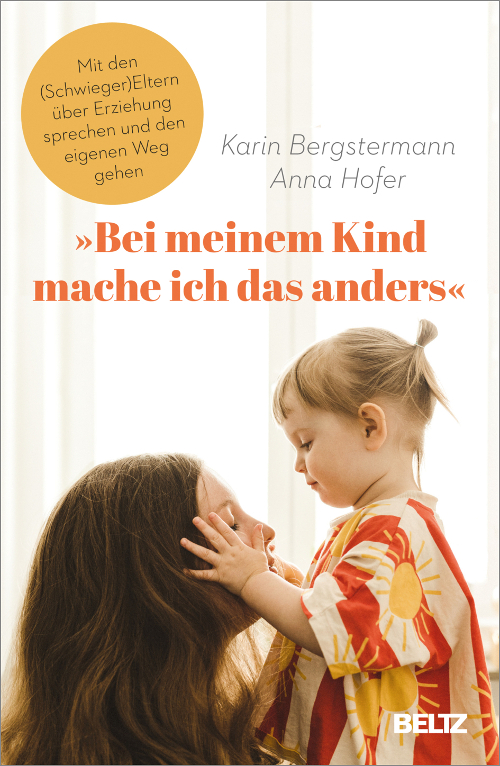Pause für Mama
"Erziehen ist nicht leicht, strengt an, reibt auf, darum muß die Mutter auch ihre Stunden der Ruhe und Auspannung haben; sie darf ihre Kräfte nicht zu schnell verbrauchen, sondern muß sie zu Rathe halten für kommende Zeiten und für die Tage und Nächte, da sie nöthiger und unentbehrlicher ist, als im Alltagsleben. Hat sie ihre Kraft verbraucht, so lange die Kinder gesund waren, was will sie thun, wenn diese krank werden? Wenn sie nachts an ihrem Bette wachen soll? Hat sie ihre Nerven so empfindlich gemacht, daß sie durch Alles gereizt, geängstigt, aufgeregt wird, - was haben die Kinder davon? Wer nimmt sich ihrer jetzt an, wenn die Mutter gar nicht mehr um ihre Lieben sein kann?"
Das Buch der Eltern, Dr Karl Oppel, 1877